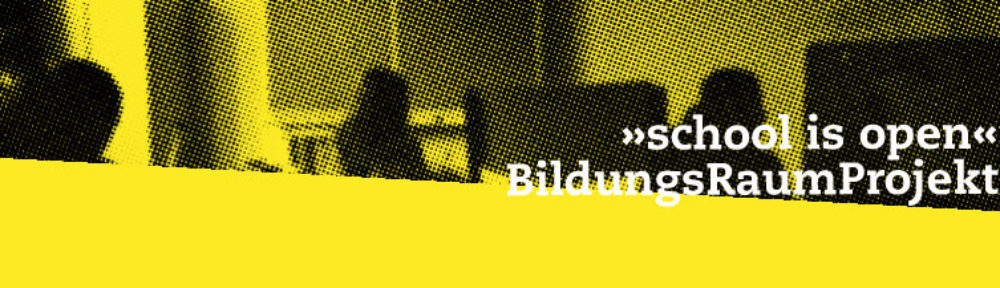7867 Lektüre-Seminar: Kunst und Politik
DozentIn: David Stoop / Sandra Vacca
Termin: Donnerstag 17.45 bis 19.15 Uhr (engl.) und Dienstag 19:30 bis 21:00 Uhr (dt.), wöchentlich nach Vereinbarung
Beginn: 15. Oktober 2009
Raum: Engl. Gruppe: R201; Dt. Gruppe: R9
Lektüreseminar
![]()
Die Selbstentfremdung der Menschheit hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erfahren lässt. Dies ist die Ästhetisierung der Politik, die der Faschismus vorantreibt. Der Kommunismus antwortet mit der Politisierung der Kunst.
(Walter Benjamin)
In Kooperation mit Studierenden des Kunsthistorischen Instituts der Universität zu Köln und der Kunsthochschule für Medien möchten wir im Lektüreseminar zum Thema „Politik und Kunst“ das Verhältnis der beiden Sphären anhand ausgewählter Texte gemeinsam diskutieren. Mögliche Fragestellungen sind dabei:
Ist Kunst widerständig? Was ist der Unterschied zwischen Kunst und Ästhetik? Was ist das Ziel von Kunst? Welche Formen nehmen Kunst und Politik unter kapitalistischen Bedingungen an? Inwieweit akzeptiert Kunst ihre Verankerung in gesellschaftlichen Verhältnissen und wo verleugnet sie diese? Was meint die Forderung nach „Politisierung der Kunst“? und: Wie ist das Verhältnis von Kunst und Politik zur Wahrheit?
Das Lektüreseminar wird sich in mehrere Lesegruppen aufteilen. Aufgrund der Zusammenarbeit mit Studierenden der Kunsthochschule für Medien wird es auch eine englischsprachige Gruppe unter der Leitung der Kuratorin Sandra Vacca geben, die die Chance bietet, englische Texte im Original zu rezipieren und auf Englisch zu diskutieren. Die unterschiedlichen Lesegruppen werden eigene Termine für ihre Sitzungen festlegen können und an ausgewählten Kompakttagen im Museum Ludwig und anderen „künstlerischen Orten“ zur gemeinsamen Diskussion praktischer Beispiele zusammenkommen. Die Texte sollen von den Studierenden selbst ausgewählt werden. Die folgende Literaturliste ist daher nur als Vorschlag zu verstehen.
Literatur:
Baumeister, Biene/Negator, Zwi (2005): Situationistische Revolutionstheorie: Eine Aneignung.
Benjamin, Walter (2006): Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Debord, Guy (1996): Die Gesellschaft des Spektakels.
Deleuze, Gilles/Guattari, Felix (2003): Was ist Philosophie? (Kapitel zur Kunst).
Harrington, Austin (2004): Art and social Theory.
Hess, Elizabeth (1995): „Guerilla Girl Power: Why the Art World Needs a Conscience“ in Nina Felshin, ed., „But is it Art“.
Read, Herbert (2002): To Hell with Culture (including: „What is Revolutionary Art?“)
Wind, Edgar (1963): Art and Anarchy. The Reith Lectures.